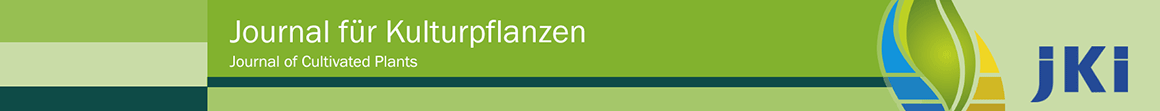
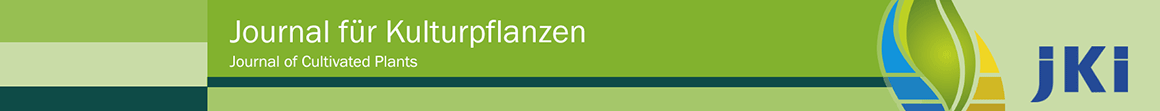
Ausgangslage im Vorratsschutz für die Erstellung der Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes und des Aktionsplanes zur Verbesserung der Situation im Vorratsschutz
Actual status in stored product protection for the development of sector specific guidelines for integrated pest management and for an action plan to improve the situation in stored product protection
Journal für Kulturpflanzen, 66 (9). S. 300–306, 2014, ISSN 1867-0911, DOI: 10.5073/JfK.2014.09.02, Verlag Eugen Ulmer KG, Stuttgart
Der ‚Nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln’ (Nationaler Aktionsplan/NAP) formuliert bestimmte Ziele, welche anhand der Ausgangslage im Pflanzenschutz durch die Vorgabe differenzierter Maßnahmen erfüllt werden sollen. Der Grad der Zielerreichung wird mittels eines Sets von Indikatoren gemessen. Bestandteil des NAP sind Leitlinien für den integrierten Pflanzenschutz auch für den Sektor Vorratsschutz sowie ein ‚Aktionsplan zur Verbesserung der Situation im Vorratsschutz’, womit sich ein Teilfokus auf den Vorratsschutz richtet. Gerade für die Entwicklung von Leitlinien ist die Kenntnis der Ausgangslage zur Formulierung von Handlungsoptionen an die Praxis essentiell. Im vorliegenden Artikel werden vorratsschutzrelevante Aspekte zur Ausgangslage beschrieben, wie sie für die oben angesprochenen Aktivitäten als Grundlage herangezogen werden können. Insgesamt ergibt sich aus der Sicht des Verbraucher-, Anwender- und Umweltschutzes derzeit keine akute Gefährdung durch oder ein Engpass bei ‚Vorratsschutzmitteln‘. Für die jeweils unterschiedlichen Anwendungssituationen sind Pflanzenschutzmittel verfügbar, jedoch ist die Anzahl wie auch die Zahl der Wirkstoffe eingeschränkt, so dass ein deutliches Resistenzrisiko besteht. Aus diesem Grunde, wegen fehlender Daten zur Abundanz von Vorratsschädlingen und den Verlusten im Vorratsschutz sowie der anzustrebenden Ziele des integrierten Pflanzenschutzes ergibt sich die Notwendigkeit eines speziellen Aktionsplans. Maßnahmen zur Verbesserung der Situation im Vorratsschutz betreffen verschiedene Bereiche von der Landwirtschaft bis zum Handel, so dass alle Akteure in die Entwicklung von Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes involviert werden müssen, damit praktikable Empfehlungen für die Praxis entstehen.
Stichwörter: Ausgangslage, Vorratsschutz, Integrierter Pflanzenschutz (IPS), Leitlinien, Nationaler Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln
The ‘National Action Plan for sustainable use of pesticides’ by the Federal Government, 2013 (National Action Plan/NAP) describes objectives, based on the status quo in stored product protection, followed by particular differentiated measures. Part of the NAP are sector specific guidelines for integrated pest management also covering the usage in stored product protection and an action plan to improve the situation in stored product protection.
Regarding consumer, user and environmental protection there is no current hazard or lack of stored product protection products. Pesticides are available for each of the very different uses in storage but the number of pesticides and their active substances is small and therefore it could occur a critical resistance risk. For this reason and considering the lack of sufficient data on the abundance and on losses due to stored product pests as well as the need for integrated pest management there is a need for an action plan to improve the situation in stored product protection. Measures in storage affect different sectors from agriculture to trade, so all actors have to be involved to get harmonized and accepted standards.
Key words: Actual status, stored product protection, integrated pest management (IPM), guidelines, National Action Plan for sustainable use of pesticides
Im ‚Nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln‘ (Nationaler Aktionsplan/NAP) der Bundesregierung sind öffentliche Stellen und/oder berufsständische Verbände angesprochen, kulturpflanzen- oder sektorspezifische Leitlinien zum integrierten Pflanzenschutz zu erstellen, wodurch auch der Vorratsschutz als einer der Einsatzbereiche des Pflanzenschutzes angesprochen ist. Diese Maßnahme dient nicht nur der Einführung des integrierten Pflanzenschutzes in Beratung und Praxis allein, sondern auch der Weiterentwicklung des integrierten Pflanzenschutzes grundsätzlich.
Der integrierte Pflanzenschutz wurde in der Richtline 2009/128/EG zusammen mit dem ökologischen Landbau (gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007) als ein Pflanzenschutz mit geringer Pestizidanwendung als förderungswürdig beschrieben. Die Einhaltung der allgemeinen Grundsätze des integrierten Pflanzenschutzes ist wie die ‚Gute Fachliche Praxis im Pflanzenschutz‘ (GFP) national im Pflanzenschutzgesetz (PflSchG § 3) verbindlich verankert.
Neben der Erstellung der Leitlinie ergibt sich aus dem Nationalen Aktionsplan eine weitere Initiative, welche ebenfalls den Vorratsschutz betrifft: So soll zur Sicherung ausreichender Pflanzenschutzverfahren in Zusammenarbeit des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft mit den Bundesländern und den betroffenen Verbänden ein „Aktionsplan zur Verbesserung der Situation im Vorratsschutz“ erarbeitet und umgesetzt werden. Beiden Maßnahmen liegen die globalen Ziele des Nationalen Aktionsplanes zugrunde. Hierunter fallen u.a. die Förderung von Pflanzenschutzverfahren mit geringen Pflanzenschutzmittelanwendungen, die Reduzierung der Risiken, die mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln verbunden sind, und darüber hinaus die Begrenzung von Pflanzenschutzmitteln auf das notwendige Maß sowie die Verbesserung der Anwendungssicherheit.
Für den Sektor ‚Vorratsschutz‘ ergeben sich angesichts einer großen Bandbreite verschiedenster Anwendungen (z.B. in einem Getreide-Silo, bei diversen Vorratsgütern in Ballen, Sackstapeln, etc.) besondere Herausforderungen. Die Auslegung eines integrierten Pflanzenschutzes nach den allgemeinen Grundsätzen in Anhang III der Richtlinie 2009/128/EG muss sich an den Besonderheiten dieses Sektors orientieren. Hier können der für verkehrsfähige Waren geforderte Anspruch einer Befallsfreiheit – im Sinne der Tilgung aller Schaderreger – und der große Stellenwert von vorbeugenden Maßnahmen genannt werden. Auch spielen ökonomische Erwägungen vor Ort eine Rolle. Dies gilt bei der Auswahl der vorbeugenden Methoden/Verfahren sowie der Alternativmaßnahmen, gegen die bei der Bekämpfung im Rahmen eines integrierten Konzepts eine chemische Pflanzenschutzmaßnahme abgestimmt werden sollte. Die tatsächlichen Verluste durch einen Befall von gelagerten pflanzlichen Erzeugnissen sind derzeit allerdings schwer bezifferbar.
Es sind für beide Maßnahmen im NAP, für die Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes im Sektor Vorratsschutz und den Aktionsplan zur Verbesserung der Situation im Vorratsschutz, in erster Linie berufsständische Verbände aufgerufen, am Geschehen mitzuwirken. Die Grundlage beider Vorhaben sind jedoch zunächst die Formulierung konkreter Ziele im Vorratsschutz und damit die Betrachtung der momentanen Ausgangslage. Der Status quo bezüglich der Mittelverfügbarkeit und die hier relevanten Gesichtspunkte im Zusammenhang mit der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Vorratsschutz sollen an dieser Stelle im Kontext der Leitlinien dargestellt werden.
Ziel des Vorratsschutzes ist es, für die Verbraucher sichere Lebensmittel pflanzlicher Herkunft am Markt bereitzustellen. Mit den zur Verfügung stehenden Maßnahmen im Pflanzenschutz nach der Ernte kann der Schutz der Pflanzenerzeugnisse im Bereich des Vorratsschutzes bereits zum präventiven Verbraucherschutz gerechnet werden. Die wesentlichen Elemente eines integrierten Vorratsschutzes‚ ‚Befallsvorbeugung‘, ‚Befallskontrolle‘ und ‚Befallsbekämpfung‘ zielen auf den Schutz der Pflanzenerzeugnisse unter Einhaltung aller geltenden Bestimmungen ab, um am Ende den Erhalt der Qualität und die Verkehrsfähigkeit zu gewährleisten.
Auch der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmaßnahmen darf dies nicht beeinträchtigen, z.B. durch Überschreitung der Rückstandshöchstgehalte, Geschmacksbeeinträchtigungen oder verminderte Verarbeitungsfähigkeit. Die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln mit den entsprechenden Anwendungsbestimmungen bildet hier die Basis für eine sichere Anwendung im Hinblick auf den Anwender- und Verbraucherschutz, letzterer steht insbesondere dann im Fokus, wenn die Pflanzenerzeugnisse in die Lebensmittelherstellungskette einfließen sollen. Die europaweit harmonisierte Festsetzung zulässiger Rückstandshöchstgehalte an Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln pflanzlicher und tierischer Herkunft sowie Kontrollen im Rahmen z.B. der amtlichen Lebensmittelüberwachung mindern Risiken für den Verbraucher und können zudem unsachgemäße Pflanzenschutzmittelanwendungen aufdecken. Dabei stellen Pflanzenschutzmittelanwendungen im Vorratsschutz nur einen kleinen Ausschnitt im gesamten Pflanzenschutz dar.
Begasungsmittel, die aktuell circa die Hälfte aller für die Anwendungen im Vorratsschutz zugelassenen Mittel (ohne Vertriebserweiterungen) ausmachen, haben allgemein den Vorteil, dass sie während der Einwirkzeit gasförmig bleiben, somit eine gute und gleichmäßige Durchdringung der zu behandelnden Vorräte ermöglichen, und dabei das Vorratsgut nicht aufwändig umgelagert werden muss. Durch die Lüftung nach der Begasung wird das Gas selbst weitestgehend entfernt, ausgasende Gebinde lassen sich vom Vorratsgut trennen. Quantifizierbare Rückstände ließen sich im Zweifelsfall jedoch feststellen, da die Bestimmungsgrenze und Analysenmethoden eine Voraussetzung für die Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sind.
Im Jahr 2011 wurden beispielsweise bei Getreide als einem gängigen Pflanzenerzeugnis in knapp 67% der Proben (insgesamt 476) im Rahmen des nationalen deutschen Kontrollprogrammes erfreulicherweise keine quantifizierbaren Rückstände nachgewiesen. Überschreitungen der Rückstandshöchstgehalte von Einzelwirkstoffen sind bei Getreide selten; 1,1% dieser Proben aber wiesen durchaus Rückstände über dem Rückstandshöchstgehalt aus. Hierbei handelte es sich um verschiedene Wirkstoffe, nämlich Isoprothiolan, Deltamethrin und Acetamiprid, von denen wiederum nur letzterer zu einer Beanstandung geführt hatte, d.h. die Überschreitung nach Berücksichtigung der analytischen Messungenauigkeit weiterhin nachweisbar blieb. Tab. 1 fasst die eher seltenen Funde von Rückstandshöchstgehaltsüberschreitungen seit 2007 zusammen, welche mit dem Vorratsschutz in Verbindung gebracht werden könnten. Im Jahr 2007 gab es bei einer einzelnen Weizenprobe deutscher Herkunft eine Überschreitung der Rückstandshöchstmenge: nachgewiesen wurde Dichlorvos. Die Verwendung von Dichlorvos ist seit 2009 nicht mehr erlaubt, es gab eine Aufbrauchfrist für einige Präparate bis Ende 2008. Das verdeutlicht, dass die Rückstandsbefunde sehr eingehend betrachtet werden müssen, um tatsächlich beurteilen zu können, ob die Ursache aus einer inländischen Vorratsschutzmaßnahme oder anderen Umständen herrührt. Insgesamt fließen Faktoren wie Herkunftsland, Klima im Ursprungsland, Kulturen, Zulassungsstand von Pflanzenschutzmitteln und Wirkstoffen ein, an die dann die Reaktion auf solche Rückstandsüberschreitungen anzupassen ist. Hierzu zählen Folgekontrollen, Widerruf von Vermarktungsgenehmigungen, u.a. Ebenfalls zeigt diese Betrachtung auf, dass der Bezug von Rückständen eines bestimmten Wirkstoffes zu einer bestimmten Anwendungstechnik im Vorratsschutz aufgrund der Datenlage nicht gelingt.
Tab. 1. Vorratsschutz-assoziierte Rückstandshöchstmengenüberschreitungen in Getreiden im Vergleich der Jahre 2007–2011. Quelle: Nationale Berichterstattung, Darstellung der Lebensmittel/Wirkstoff-Kombinationen mit quantifizierten Rückständen (nur „surveillance“ Proben. RHG = Rückstandshöchstgrenze, N = Zahl der untersuchten Proben des jeweiligen Getreides, ** berechnet als Bromid). (BVL, 2014a)
Jahr | >RHG | Lebensmittel | N | Wirkstoff |
2011 | 1 | Reis | 122 | Bromhaltige Begasungsmittel ** |
1 | Reis | 174 | Deltamethrin | |
2010 | 1 | Weizen | 81 | Piperonylbutoxid |
2009 | 0 | – | – | – |
2008 | 0 | – | – | – |
2007 | 1 | Weizen | 203 | Dichlorvos |
Anhand dieser Daten zeigt sich, dass derzeit grundsätzlich kein akuter Handlungsbedarf hinsichtlich der Rückstandshöchstgehaltsüberschreitungen bei Pflanzenerzeugnissen als Folge des Vorratsschutzes erkennbar ist. Nicht außer Acht gelassen werden sollte aber, dass hier Risiken, auch gegebenenfalls durch die kumulative Wirkung von Mehrfachrückständen, bestehen, die unterstützt durch integrierte und nachhaltige Maßnahmen kontinuierlich hin zu weniger bedenklichen Pflanzenschutzmitteln verringert werden sollten. Zu nennen sind hier beispielhaft
a) die Entwicklung moderner Verfahren für bekannte wirksame Pflanzenschutzmittel, beispielsweise zur Reduzierung des Mittelaufwandes, und |
b) die Erforschung praxisreifer chemischer Maßnahmen auf der Basis pflanzlicher/natürlicher, sehr wirtsspezifischer Wirkstoffe, welche hochwirksam sind, kurze Einwirkzeiten erfordern und für ‚just-in-time‘ Anwendungen einsetzbar sind, auch um einen akuten Massenbefall nachhaltig vorzubeugen bzw. bekämpfen zu können. |
Die Anwendungen von Pflanzenschutzmitteln im Vorratsschutz reichen von der Ausbringung inerter Stäube über den Einsatz von Spritz- und Nebelmitteln bis hin zur Begasung. Der Ort der Ausbringung ist dabei verglichen mit Pflanzenschutzmittelanwendungen auf dem Feld durch die Anwendung in Innenräumen, z.B. in einem Lager, räumlich begrenzt. Bei Begasungen kommen durch Undichtigkeiten und insbesondere durch die Lüftung des begasten Raumes jedoch Einträge in die Umwelt vor. Begasungsmittel werden „abgelüftet“, das bedeutet, dass das behandelte Lager, die Gebäude, der Container usw. nach der Einwirkzeit geöffnet werden, wodurch sich das Restvolumen an Gas rasch in der Umgebung/umgebenden Atmosphäre verdünnt.
Die Anwendung von Spritz- und Nebelmitteln ist auf das geschlossene Lager begrenzt. Bislang gibt es keine Anhaltspunkte dafür, dass wenig flüchtige Wirksubstanzen wie Pirimiphos-methyl eine nennenswerte Beeinträchtigung für Nichtzielflächen rund um die Lagerstätte darstellen (Klementz, 2003).
In Tab. 2 sind die Inlandsabsatzmengen von ausgewählten Pflanzenschutzmitteln mit Zuordnung zum Einsatzbereich ‚Vorratsschutz‘ aus dem Jahr 2012 dargestellt (BVL, 2014b). Eine Ausnahme bilden die Anwendungen von Aluminiumphosphid zur Bekämpfung von Schermaus und Maulwurf, die bei den nachfolgenden Berechnungen vernachlässigt werden. Diese Mengenbereiche geben in grober Näherung Aufschluss über einen potentiellen maximalen Eintrag in die Umwelt. Nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse ist dabei jedoch für keines der im Vorratsschutz gebräuchlichen Gase Kohlendioxid, Sulfurylfluorid und Phosphorwasserstoff von einem akuten Risiko allein durch die Anwendungen im Vorratsschutz (z.B. anthropogener Treibhauseffekt, saure Niederschläge, weiträumige Verfrachtung, Stabilität in der oberen Atmosphäre) auszugehen, wenn alle geltenden Sicherheitsstandards erfüllt werden (BVL, 2014b–c; Sulbaek Andersen et al., 2009; Papadimitriou et al., 2008). Dies ist zum Teil in den vergleichsweise geringen Mengen (z.B. CO2 durch Vorratsschutzmaßnahmen verglichen mit der Verbrennung fossiler Brennstoffe) als auch durch Abbauprozesse (z.B. die indirekte Photooxidation von Phosphorwasserstoff durch OH-Radikale) begründet. Zur Verweildauer in der Atmosphäre und den Konzentrationen in der Troposphäre müssen darüber hinaus im Rahmen der Wirkstoffgenehmigung weitere Daten einbezogen werden, damit in der Europäischen Kommission aktuelle Kenntnisse zum Verhalten des Stoffes fortlaufend berücksichtigt werden können.
Tab. 2. Absatzmengen für Wirkstoffe in zugelassenen Pflanzenschutzmitteln mit Zuordnung zu Vorratsschutzmaßnahmen (2012, Inland, Mengen über 1t). * Äquivalente Mengen gasförmiger Phosphorwasserstoff (PH3), (Quelle BVL, 2014b)
Wirkstoffe | Absatzmenge 2012 | Gasförmig oder gasentwickelnd | ||||
> 10000 t | 25–100 t | 10–25 t | 2,5–10 t | 1–2,5 t | ||
Kohlendioxid | ||||||
Aluminiumphosphid |
| |||||
Sulfurylfluorid | ||||||
Kieselgur | ||||||
Pirimiphos-methyl | ||||||
Magnesiumphosphid |
| |||||
Neben der Beachtung des Verbraucherschutzes sind im Vorratsschutz weitere Risiken von Pflanzenschutzmittelanwendungen nicht unerheblich. Ein hoher Stellenwert kommt dem Anwenderschutz und dem Schutz von unbeteiligten Dritten zu, da gerade bei der Anwendung von gasförmigen oder gasentwickelnden Präparaten, von Spritz- oder Nebelmittel in Lagerstätten für diese Personengruppen besondere Risiken bei, während und nach der Applikation erwachsen. Das Niveau der Sicherheit bei der Ausbringung giftiger Gase und die Sachkundeanforderungen an professionelle Anwender sind insbesondere in Deutschland hoch. Trotzdem können neue Erkenntnisse jederzeit zu einer veränderten Risikobeurteilung führen. Dies hat mitunter dazu Anlass gegeben, dass in der jüngeren Vergangenheit die Anwendungen zugelassener Mittel im Vorratsschutz eingeschränkt oder Mittelzulassungen mit bestimmten Wirkstoffen widerrufen worden sind, wie beispielsweise bei den Wirkstoffen Pirimiphos-methyl (Widerruf der handgeführten Anwendung) und Dichlorvos (Nicht-Genehmigung des Wirkstoffes und dadurch Wegfall z.B. der Verdunstungsstrips).
Über das Schädlingsauftreten im Vorratsschutz in Deutschland gibt es eine Reihe von Abhandlungen und Informationen (Weidner, 1983; Weidner und Sellenschlo, 2010; Engelbrecht und Reichmuth, 2005; TRNS, Reichmuth et al., 2007). Die Abundanz, die Häufigkeit und das Artenspektrum auftretender Vorratsschädlinge lassen sich weitaus schwieriger ermitteln. Hierzu liegen bislang kaum aktuelle Daten vor.
Ebenfalls lassen sich die jährlich befallenen Tonnagen an pflanzlichen Erzeugnissen, die eine Vorratsschutzmaßnahme notwendig machen, schwer beziffern. Auch über die Verluste in den Lägern stehen kaum robuste Daten zur Verfügung. Es gibt Verlustschätzungen für den Bereich nach der Ernte, aber eine Aufschlüsselung, wann unzureichender Vorratsschutz und Vorratsschädlinge die Ursache waren, fehlt (Anonymus, 2013a). Der geschätzte Verlust bei Getreide im Nacherntebereich liegt bei insgesamt 3,3%. Durch eine Verbesserung im Bereich der Lagerung können diese Verluste etwa um 5% reduziert werden. Der Einfluss der Lagerungstechnik auf das Reduktionspotential bei den Lagerungsverlusten ist begrenzt. Neben einem Schädlingsbefall gingen insbesondere auch die Verluste durch Getreideatmung, Ein- oder Auslagerung oder auch durch die Trocknung als Faktoren in die Betrachtung ein. Die wirtschaftliche Rentabilität von Investitionen zur Optimierung von Lagerstätten ließ sich nicht ermitteln (Anonymus, 2013a).
Getreidepartien mit Schädlingsbefall können z.B. durch Begasung saniert werden. Im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln stellt sich die Frage, wie oft es überhaupt zu einem Schadensfall und zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln bei der Bekämpfung von Vorratsschädlingen kommt. Auch hierzu fehlen robuste Daten.
Mittels einer groben Einschätzung auf der Basis des Inlandsabsatzes an Aluminiumphosphid für 2012 (Tab. 2) und anhand der Betrachtung von Aufwandmengen, welche bei Getreidebegasungen eingesetzt werden, lässt sich beispielsweise das Ausmaß des Befalles mit Handlungsbedarf in einer groben Näherung eingrenzen. Für diese Abschätzung wurden die Inlandsabsatzmenge an Aluminiumphosphid (Insektizid und Rodentizid) und eine mittlere Aufwandmenge von 30 g/t zugrunde gelegt. Die Zahlen beruhen auf dem Inlandsabsatz unter der Annahme, dass diese abgesetzte Menge auch tatsächlich und ausschließlich in Getreide eingesetzt wurde. Mit 25–100 t Inlandsabsatz an Aluminiumphosphid (Tab. 2) könnte sich die Menge an für begasungswürdig befundenem Vorratssgut (Getreide, Hülsenfrüchte, Kaffee, Kakao u. a.) mit Schädlingsbefall demnach zwischen ca. 833 000 t und 3 333 000 t bewegt haben, was einem Anteil an der Gesamtgetreideernte 2012 (BMEL Statistik) mit Schädlingsbefall zwischen 1,8 bis maximal 7,3% in Deutschland entspräche. Dieser Anteil würde sich weiter verringern, würden der Abschätzung höhere Aufwandmengen zugrunde gelegt. Dies zeigt auf, dass in der alltäglichen Praxis nicht grundsätzlich und regelmäßig durchgreifende Maßnahmen nötig sind. Neben dieser worst-case Annahme beschreibt Burghause (2013) Tendenzen mit Einsparungspotential in Rheinland-Pfalz: Darin hat sich die Zahl der Begasungen im Vorratsschutz seit 1999 von jährlich 40 auf 20 pro Jahr reduziert, was mit dem verstärkten Einsatz der Kühlung und kürzeren Lagerzeiten in Verbindung gebracht wird.
Begasungen mit Sulfurylfluorid oder Phosphorwasserstoff als Vorratsschutzmaßnahme lassen sich dokumentieren, da sie behördlich angemeldet werden müssen. Hieraus lässt sich eine gewisse Vorstellung zum Befall mit vorratsschädlichen Insekten entwickeln, welchem mit möglichst durchgreifenden Methoden begegnet werden sollte.
Es scheint aufgrund der ohnehin nur auf Schätzungen beruhenden Zahlen zu Verlusten der Anteil, welcher durch Schädlingsbefall verursacht wurde, eher gering zu sein. Der Schaden ist allerdings aus der betriebswirtschaftlichen Sicht, beispielsweise eines Erzeugers, bei einer Wertminderung des Erntegutes oder gar einem Totalverlust erheblich. Aus diesem Grunde muss auch bei der Formulierung von Leitlinien für den Vorratsschutz das Schadensszenario insbesondere aus der Sicht des individuell betroffenen Besitzers der Ernteerzeugnisse berücksichtigt werden.
Derzeit steht für den Vorratsschutz eine eher geringe Anzahl an Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung (Tab. 2). Der oft angesprochene Rückgang von Zulassungen im Einsatzgebiet ‚Vorratsschutz‘ geht teilweise auf Rodentizide zurück. Seit dem Meldejahr 2012 werden die Wirkstoffe Aluminium- und Magnesiumphosphid nicht mehr zu den rodentiziden Wirkstoffen, die in Mitteln für den Vorratsschutz zugelassen worden sind, gezählt. Viele Bekämpfungsmaßnahmen gegen Nager werden inzwischen dem Biozid-Bereich zugeordnet, weil der hauptsächliche Anwendungszweck der Schutz der menschlichen Gesundheit und die hygienischen Erwägungen sind.
Eine einschneidende Veränderung bedeutete der Wegfall des Wirkstoffes Brommethan (alternative Bezeichnung: Methylbromid) im Jahr 2005, dieser hat jedoch in Sulfurylfluorid gerade für die Mühlenentwesung einen Ersatz gefunden. Ebenso bieten thermische Verfahren in Mühlen und für leere Räume allgemein eine Möglichkeit der Schädlingsbekämpfung.
Die Phosphide (Tab. 2) lassen sich auf die Wirkung von Phosphorwasserstoff (PH3) zurückführen, so dass tatsächlich nicht vier verschiedene, sondern lediglich ein Wirkstoff, nämlich PH3, für die Verfügbarkeit von Mitteln und Wirkstoffen berücksichtigt werden kann.
Bei einigen Anwendungen reduziert sich die praktikable Bekämpfung von Schädlingen mit chemischen Mittel alleinig nur noch auf einen Wirkstoff. Für die ausschließliche Bekämpfung von Motten in den warmen Sommermonaten in Räumen zur Langzeitlagerung von Getreide steht nur ein Pflanzenschutzmittel im Vorratsschutz zur Verfügung. Auch ist die Auswahl an Wirkstoffen, welche in praktikablen und wirtschaftlichen Verfahren zur durchgreifenden Entwesung, z.B. von Rohkakao eingesetzt werden kann, gering. Als chemisches Verfahren gegen Holzschädlinge im Vorratsschutz ist derzeit nur die Begasung mit Sulfurylfluorid verfügbar. Für die Bekämpfung von Vorratsschädlingen im Rahmen eines ökologischen Landbaus fehlt es bei einem fortgeschrittenen Befall in großen Getreidepartien an wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten zur Entwesung, da nur Pyrethrine zur Behandlung von Räumen zur Verfügung stehen.
Von flächendeckend auftretenden Resistenzen gegen Pflanzenschutzmittel im Vorratsschutz muss in Deutschland gegenwärtig nicht ausgegangen werden, wenngleich mitunter an importierten Waren von Phosphorwasserstoffresistenzen berichtet wird. Ebenfalls werden im europäischen Ausland z.B. resistente oder weniger sensible Stämme gegen Deltamethrin bei vorratsschädlichen Insekten beobachtet (Kljajic und Peric, 2006).
Die Richtlinie 2009/128/EG ordnet der Erstellung von Leitlinien öffentlichen Stellen und/oder Organisationen zu, die bestimmte berufliche Verwender vertreten. Als berufliche Verwender gelten die Personen, welche im Rahmen ihrer Tätigkeit Pflanzenschutzmittel anwenden. Im Nationalen Aktionsplan werden für die inhaltliche Erarbeitung zunächst die berufsständischen Verbände und beratenden Organisationen auf Länderebene genannt. Der Kreis der beteiligten Gruppen wird um relevante Verbände des Verbraucherschutzes sowie des Umwelt- und Naturschutzes erweitert. Als öffentliche Stellen werden beratende Institutionen der Länder und das Julius Kühn-Institut genannt. Im späteren Prozess bei der Schaffung von Anreizen zur freiwilligen Umsetzung der Leitlinien werden die Bundesregierung, die Länder und betroffene Verbände aufgeführt.
Für den Sektor ‚Vorratsschutz‘ spiegelt der Begriff „beruflicher Verwender“ ein breites Spektrum von verantwortlichen Aufgaben bei der Anwendung von Pflanzenschutzmaßnahmen wider. So, wie die Situationen im Vorratsschutz vielfältig sind, gestaltet sich auch der Kreis der Anwender von Pflanzenschutzmitteln entsprechend vielschichtig. Dieser reicht vom Landwirt über den Lagerhalter bis hin zum Betriebsleiter in Mühlen und umfasst ebenso die professionellen Schädlingsbekämpfer. Eine Verbandszugehörigkeit ergibt sich daraus einerseits aufgrund des Berufstandes (z.B. Agrarwirtschaftsverband) und/oder andererseits aufgrund einer programmatischen Ausrichtung (z.B. Ökoverbände).
Durch diese Interessensvertretungen bestehen bereits diverse Ausführungen und Richtlinien für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Im Falle der Ökoverbände gibt jeder Verband jeweilige privatrechtliche Richtlinien heraus, auf deren Grundlage die interne Zertifizierung erfolgt (z.B. Anonymus, 2013b). Eine Zertifizierung nach der Öko-Verordnung (EG) Nr. 834/2007 erfolgt unabhängig von einer Verbandszugehörigkeit, aber selbstverständlich gemäß den allgemeinen und grundsätzlichen Vorgaben der Verordnung. Für die Einlagerung von Interventionsgetreide im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung gelten die Vertragsbedingungen, welche detailliert Vorgaben für z.B. ein HACCP-Konzept enthalten (BLE). Im Bereich der biologischen Schädlingsbekämpfung existieren ebenso detaillierte Ausarbeitungen (TRNS, 2013; Schöller und Prozell, 2005; Marschall et al., 2007).
Zusätzlich wird die Lagerhaltung selbst beschrieben, wie im Leitfaden des Verbands Deutscher Mühlen e.V. (Anonymus, 1997), beim Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe e.V. (Anonymus, 2007) oder wiederum bei Ökoverbänden (z.B. Anonymus, 2012). Seitens der beratenden Institutionen der Bundesländer finden sich weitere Informationsschriften zur Lagerung (Anonymus, 2010).
Neben der Vielfalt hinsichtlich der beteiligten Akteure im Vorratsschutz ergibt sich die Situation, dass Bekämpfungsmaßnahmen im Vorratsschutz sehr oft als externer Auftrag vergeben werden. Es wird ersichtlich, dass oftmals der Besitzer der Pflanzenerzeugnisse und der berufliche Anwender nicht identisch sind. In diesem Fall muss die Einhaltung der Leitlinie Teil der Auftragsvergabe sein und vom Auftraggeber überwacht werden.
Leitlinien für den Vorratsschutz müssen dieser Vielfalt gerecht werden und sollten idealerweise von allen beteiligten Akteuren getragen werden, auch wenn die Vorratsschutzmaßnahmen aus verschiedenen Blickwinkeln gesehen werden.
Aufgrund der hier erörterten Punkte zeichnet sich für den Sektor Vorratsschutz kurz- und langfristiger Handlungsbedarf ab. Dieser könnte bei der Mittelverfügbarkeit, neuen, auch nicht-chemischen Verfahren, einer wissenschaftlichen Untersuchung zu Befallsdaten und Schädlingsabundanz und -ausbreitung sowie bei ökonomischen Aspekten im Vorratsschutz angesiedelt sein. Bei der Mittelverfügbarkeit können sich jederzeit neue Gründe ergeben, welche die Zulassungen für einzelne Mittel bis hin zum kompletten Wegfall einschränken.
Dies hat in zweierlei Hinsicht Bedeutung: Zum einen fußt ein ‚Aktionsplan zu Verbesserung der Situation im Vorratsschutz‘ auf den verbesserungswürdigen Umständen. Zum anderen stellt es sich für die Erarbeitung der spezifischen Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes im Sektor Vorratsschutz als Herausforderung dar, einen Konsens bei allen beteiligten Akteuren zu erzielen sowie alle relevanten bestehenden Handlungsempfehlungen und Richtlinien zu sammeln, deren Inhalte zu erfassen und zu berücksichtigen. Im Idealfall lassen sich bestehende oder künftige, privatrechtliche oder verbandsinterne Richtlinien oder Empfehlungen schlüssig aus diesen Leitlinien ableiten, zudem, wenn die verantwortlichen Interessengruppen im Bereich Vorratsschutz eingebunden werden.
Gemäß dem Nationalen Aktionsplan ergibt sich für die Erstellung der sektorspezifischen Leitlinien des integrierten Pflanzenschutzes außerdem die Gelegenheit, aufgrund neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse höhere Ansprüche an die Vorratsschutzpraxis zu formulieren. Diese können ein Ziel beschreiben, das anerkanntermaßen befördert werden sollte und perspektivisch Einzug in die breite Praxis finden soll. Agrarbetriebe oder Lebensmittel verarbeitende Betriebe, welche sich als Demonstrationsbetriebe zur Verfügung stellen, leisten hierfür einen wertvollen Beitrag. Die Etablierung solcher Demonstrationsbetriebe ist in diesem Sinne eine förderungswürdige Maßnahme. Auch dieses Ziel kann nur auf der Grundlage der Ausgangssituation gefasst werden.
Die Nennung von Produkten und Verfahren in diesem Text impliziert keinerlei Handlungsempfehlung oder rechtlich bindende Form. Für Informationen zu Zulassungen im Pflanzenschutz und Biozidbereich sei auf das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) und auf die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) als zuständige Zulassungsbehörden verwiesen, Verfahren im ökologischen Landbau sind mit den jeweiligen Verbänden abzustimmen.
Anonymus, 1997: Verband Deutscher Mühlen e.V.: Hygiene-Leitlinien für Getreidemühlen (10/1997).
Anonymus, 2007: Leitlinie Umschlag und Lagerung Getreide, Futtermittel und Ölsaaten. ZDS, Zentralverband Deutscher Seehafenbetriebe.
Anonymus, 2010: Qualität Sichern, Risiken vermeiden, Getreide und Körnerleguminosen im landwirtschaftlichen Betrieb – vom Saatgut über das Lager bis zum Verkauf. 2. Aufl. 2010, Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen.
Anonymus, 2013b: Naturland – Verband für ökologischen Landbau e.V. Naturland Richtlinien Verarbeitung Fassung 5/2013.
Anonymus, 2013a: Einschätzung der pflanzlichen Lebensmittelverluste im Bereich der landwirtschaftlichen Urproduktion. Bericht im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). URL http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Ernaehrung/WvL/Studie_Lebensmittelverluste_Landwirtschaft.pdf?__blob=publicationFile, Abgerufen am 19.03.2014.
BLE (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung), 2013: Warenspezifische Bestimmungen. URL http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/01_Markt/04_Intervention/Getreide/131108_WarenspezifischeBestimmungenGetreide.html?nn=2305596, Abgerufen am 21.03.2014.
BMEL Statistik: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, Statistik und Berichte des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, http://berichte.bmelv-statistik.de/SJT-3072200-0000.pdf, Abgerufen am 03.07.2014.
BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), 2014a: Tabellen zur Nationalen Berichterstattung Pflanzenschutzmittelrückstände in Lebensmitteln. URL http://www.bvl.bund.de/DE/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/02_AmtlicheLebensmittelueberwachung/09_PSMRueckstaende/02_nb_psm_archiv, Abgerufen am 21.03.2014.
BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), 2014b: Bericht – Absatz an Pflanzenschutzmitteln in der Bundesrepublik Deutschland. Ergebnisse der Meldungen gemäß § 64 Pflanzenschutzgesetz für das Jahr 2012. URL http://www.bvl.bund.de/psmstatistiken, Abgerufen am 21.03.2014.
BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit), 2014c: Amtliches Zulassungsverzeichnis Teil V. URL http://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/01_OnlineDatenbank/psm_onlineDB_node.html, Abgerufen am 21.03.2014.
Burghause, F., 2013: Vorratsschutz im Bundesland Rheinland-Pfalz. Journal für Kulturpflanzen 65 (5). S. 180-183.
Engelbrecht, H.-O., C. Reichmuth, 2005: Schädlinge und ihre Bekämpfung: Gesundheits-, Vorrats- und Holzschutz. 4. Aufl., Hamburg, B. Behr’s Verlag, 2005, 404 S.
GFP (Gute fachliche Praxis), BMELV (Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz), 2010: Grundsätze für die Durchführung der Guten fachliche Praxis im Pflanzenschutz. BAnz. Nr. 76a vom 21. Mai 2010.
Klementz, D., 2003: Pflanzenschutzmittelemissionen aus Gebäuden: Messung der Emission und der damit verbundenen Belastung von Wasser, Boden und Luft in unmittelbarer Gebäudenähe – Teil 2: Vorratslager. Forschungsbericht 200 67 407 – UBA-FB 000458/2TEXTE/UmweltbundesamtUmweltbundesamt. Berlin Heft: 63.
Kljajic, P., I. Peric, 2006: Susceptibility to contact insecticides of granary weevil Sitophilus granarius (L.) (Coleoptera: Curculionidae) originating from different locations in the former Yugoslavia. Journal of Stored Products Research 42, 149-161.
Marschall, C., E. Lorenz, S. Mahnke-Plesker, A. Beck, 2007: Leitfaden zur Schädlingsbekämpfung für Betriebe, die ökologische Lebensmittel lagern, verarbeiten und handeln. 2006 überarb. von: S. Prozell, M. Schöller, A. Hoppe; Hrsg.: BNN Herstellung und Handel e.V., BÖLW e.V., Verband der Reformwaren – Hersteller, Berlin, 2007.
NAP, Bekanntmachung des Nationalen Aktionsplans zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmittel vom: 10.04.2013, Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. BAnz AT 15.05.2013 B1.
Papadimitriou, V.C., R.W. Portmann, D.W. Fahey, J. Mühle, R.F. Weiss, J.B. Burkholder, 2008: Atmospheric Chemistry of Sulfuryl Fluoride: Reaction with OH Radicals, Cl Atoms and O3, Atmospheric Lifetime, IR Spectrum, and Global Warming Potential. J. Phys. Chem. A, 2008, 112 (49), 12657-12666.
PflSchG, Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz – PflSchG), Pflanzenschutzgesetz vom 6. Februar 2012 das zuletzt durch Artikel 4 Absatz 87 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist. (BGBl. I S. 148, 1281).
Reichmuth, C., M. Schöller, C. Ulrichs, 2007: Stored product pests in grain. Morphology – Biology – Damage – Control. Bonn, AgroConcept Verlagsgesellschaft.
Richtlinie 2009/128/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden.
Schöller, M., S. Prozell, 2005: Richtlinien der Verbände des ökologischen Landbaus zum Vorratsschutz, Analyse und praktische Umsetzung. Gesunde Pflanzen 57, 1-5.
Sulbaek Andersen, M.P., D.R. Blake, F.S. Rowland, M.D. Hurley, T.J. Wallington, 2009: Atmospheric Chemistry of Sulfuryl Fluoride: Reaction with OH Radicals, Cl Atoms and O3, Atmospheric Lifetime, IR Spectrum, and Global Warming Potential. Environ. Sci. Technol., 2009, 43 (4), 1067-1070.
TRNS, 2013: Technische Regeln und Normen der Schädlingsbekämpfung, Standards für den professionellen Anwender, Gesundheits- und Vorratsschutz. Ausschuss Technische Regeln und Normen der Schädlingsbekämpfung (Hrsg.), 2. Aufl., 2013.
Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91.
Weidner, H., 1983: Vorrats- und Materialschädlinge (Vorratsschutz), In: Kurt Heinze (Hrsg.), Leitfaden der Schädlingsbekämpfung Bd. 4. 4., völlig neu bearb. Aufl., Stuttgart, Wiss. Verl.-Ges.
Weidner, H., U. Sellenschlo, 2010: Vorratsschädlinge und Hausungeziefer: Bestimmungstabellen für Mitteleuropa. 7. Aufl. überarb. von Udo Sellenschlo, Heidelberg, Spektrum Akad. Verl.