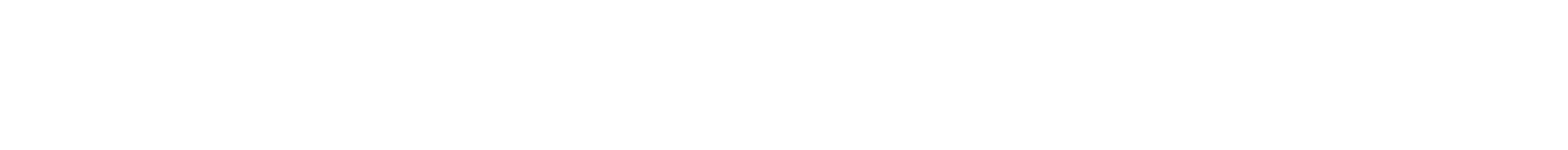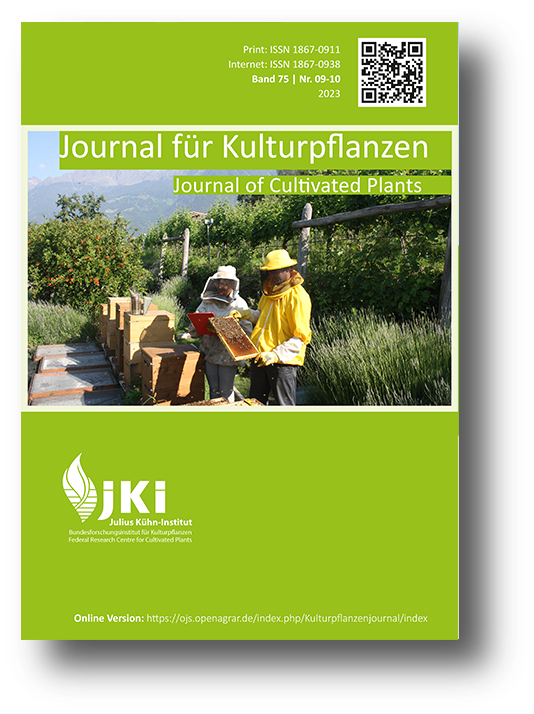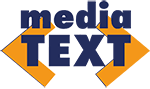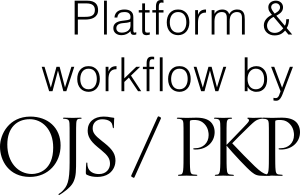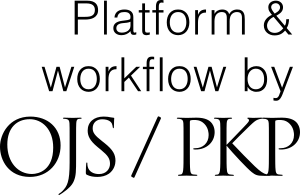rDNA-Analysen weisen darauf hin, dass der eingewanderte kryptische Mittelmeer-Feuerschwamm (Fomitiporia mediterranea) ursächlich ist für das Absterben gepfropfter Kugelrobinien (Robinia pseudacacia 'Umbraculifera')
DOI:
https://doi.org/10.5073/JfK.2023.09-10.03Schlagworte:
Klimawandel, invasive Art, Neomycet, Mediterranean elbowpatch crust, Phellinus, urbane Mykologie, weites Wirtspektrum, WeißfäuleAbstract
Ein epidemisches Auftreten des Polsterförmigen Feuerschwamms (Fomitiporia punctata, Agaricomycotina, Fungi) wurde in den vergangenen Jahren auf verschiedenen Laubgehölzen (Wisteria floribunda, Platanus acerifolia, Robinia pseudoacacia) im innerstädtischen bzw. innenstadtnahen Teil von Karlsruhe (Baden-Württemberg, Deutschland) beobachtet. Zahlreiche gepfropfte rund 40 Jahre alte Kugelrobinien (R. pseudoacacia 'Umbraculifera') sind krank oder sind bereits abgestorben. Eine rDNA-Analyse (Marker: ITS) auf der Basis von Frisch- und Herbarmaterial zeigte, dass es sich mitnichten um F. punctata sondern um den eingewanderten morphologischen Doppelgänger Mittelmeer-Feuerschwamm (F. mediterranea) handelt. Diese Art war bisher in Deutschland überwiegend auf Wein (Vitis vinifera) bekannt. Die Symptome bei Kugelrobinien werden, u. a. anhand von Stammquerschnitten, detailliert beschrieben und illustriert. Eine Verbreitungskarte der beiden Pilzarten wird für Karlsruhe erstellt. Der Fund (Herbarbeleg) von F. mediterranea auf C. avellana von 1988 aus Rheinland-Pfalz ist der Erstnachweis der Art in Deutschland. Die Frage, wann ungefähr die Art nach Deutschland einwanderte ist Gegenstand der Diskussion.
Veröffentlicht
Ausgabe
Rubrik
Lizenz
Copyright (c) 2023 Die Autoren/Die Autorinnen

Dieses Werk steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International.
Der Inhalt dieser Zeitschrift ist lizenziert unter der Creative Commons - Namensnennung 4.0 Lizenz. Sie dürfen das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten, remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für beliebige Zwecke, solange die Originalpublikation zitiert wird (Autoren, Titel, Jahr, Zeitschrift, Band, Nummer, Seiten).
Urheber- und Nutzungsrechte verbleiben beim Autor. Die Autoren räumen dem Journal für Kulturpflanzen sowie dem Julius Kühn-Institut und dem OpenAgrar-Repositorium das nicht-ausschließliche Nutzungsrecht ein, das Werk zu verbreiten und zu verwerten.